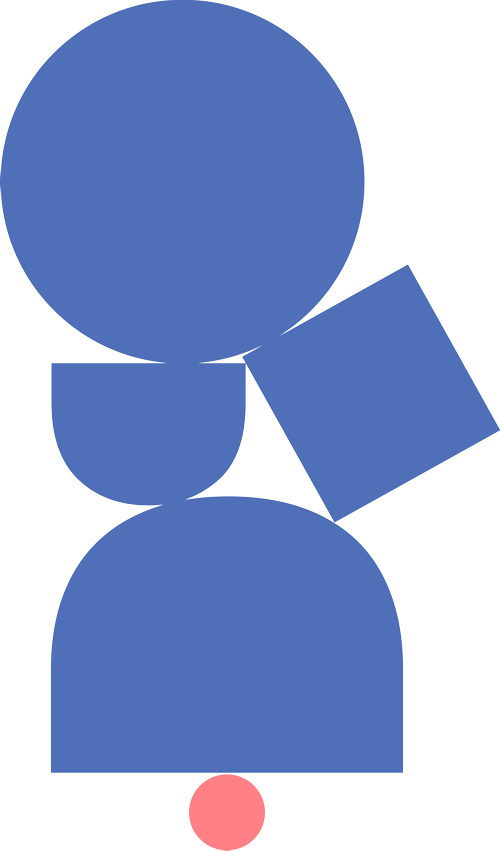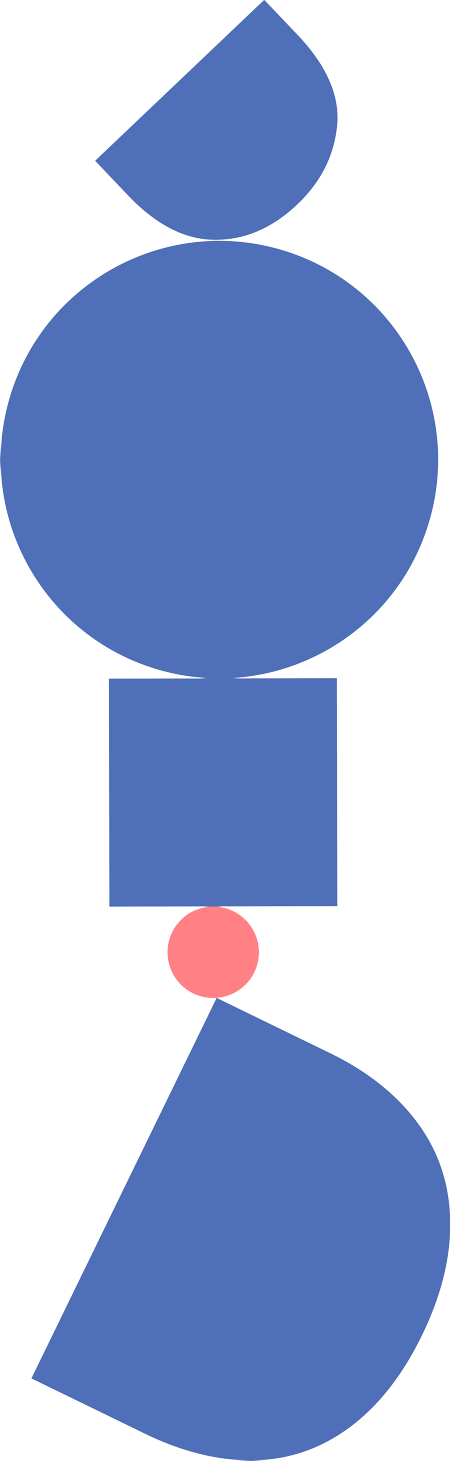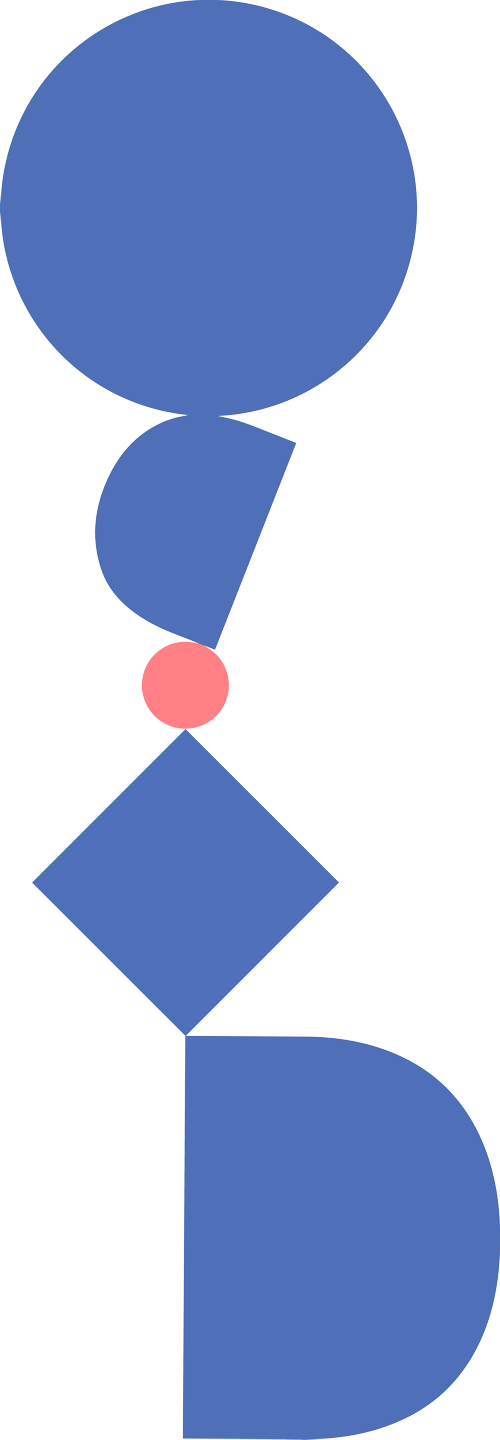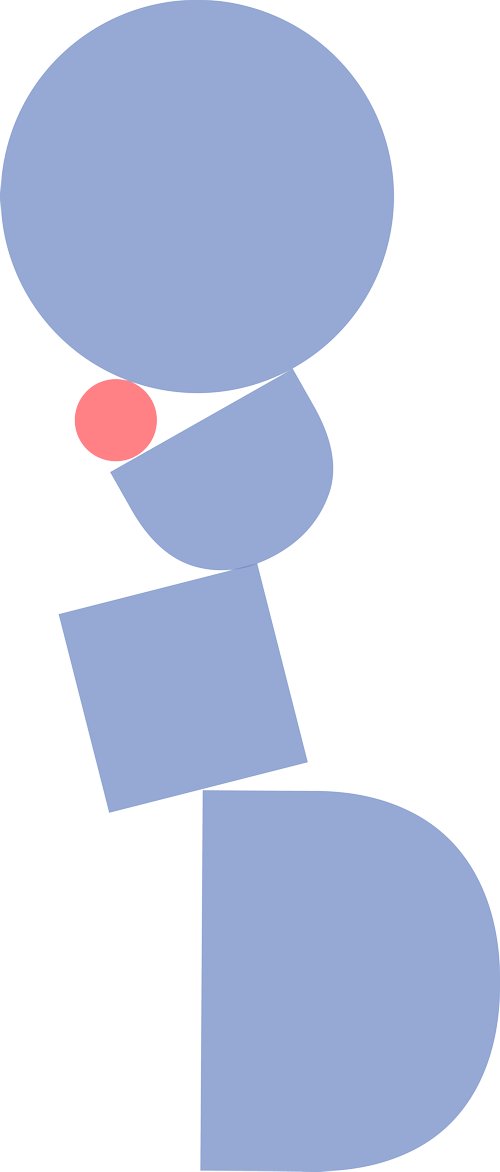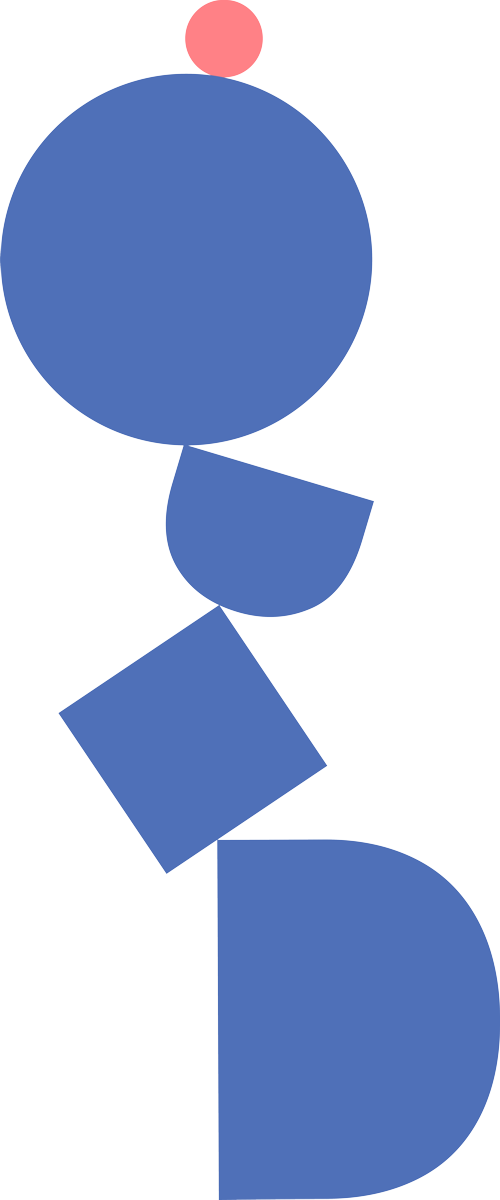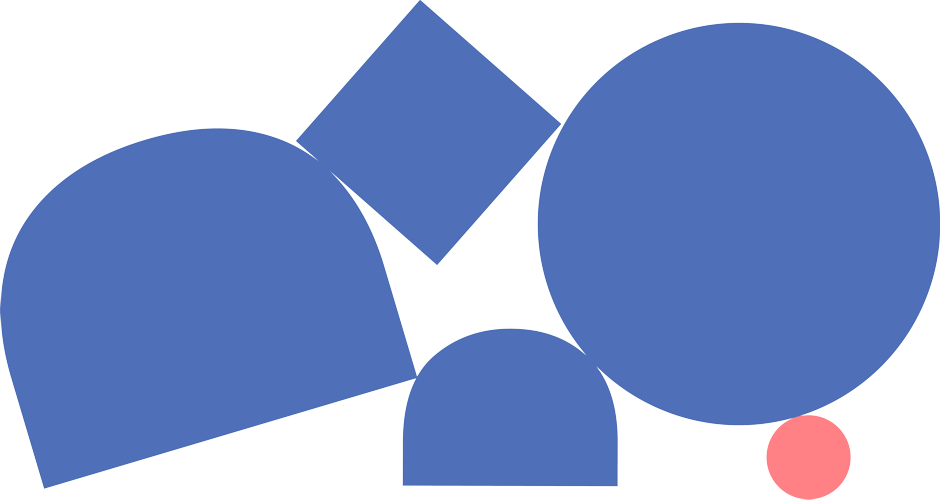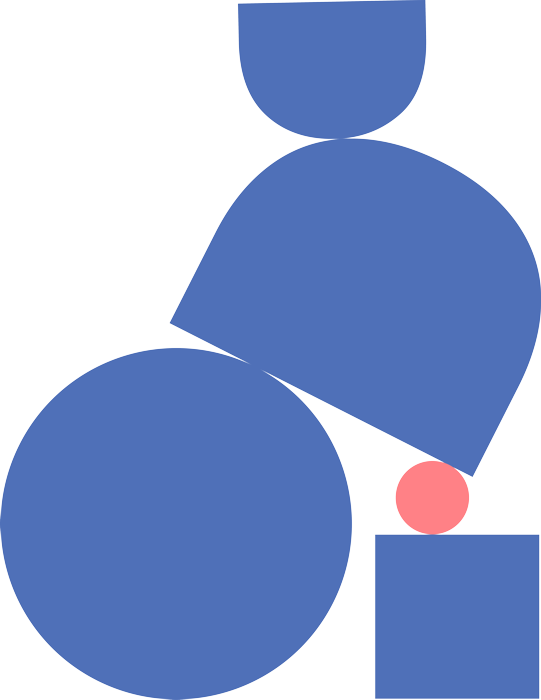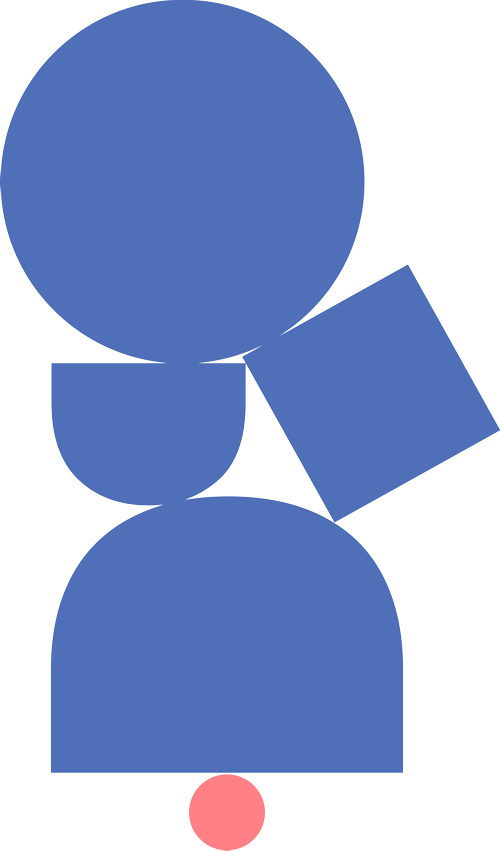
Geschichte
20 Jahre «Hefe im Teig»
Über die Entstehung der DJS
von Emil Müller, November 1998; verfasst im Auftrag der DJS zum 20jährigen Jubiläum
Die Geschichte der DJS ist die Geschichte der Linken in der Schweiz: Die spektakulären Auftritte in den 80er Jahren wurden abgelöst von pragmatischer Sachpolitik. Im Unterschied zu vielen anderen linken Gruppierungen haben die DJS jedoch den Weg in die 90er Jahre gefunden – und haben erst noch Erfolg.
«Durch eine Pressekonferenz in Bern erfuhr man vor kurzem, dass sich in unserem Land eine ‹Vereinigung Demokratische Juristen Schweiz (DJS)› gebildet hat. Schon dieses Etikett ist eine Anmassung – als ob alle Juristen, die diesem neuen Verein selbsternannter Superdemokraten nicht angehören, zu wenig demokratisch wären.» Solches war am 4. Januar 1979 in der Zeitung «Die Ostschweiz» zu lesen. Unschwer ist festzustellen, dass der Schreiber Klaus Ammann gar keine Freude an der Gründung der DJS hatte. Er sah gar die Schweiz in ihren Grundfesten erschüttert und riet deshalb schon im Titel seiner Kolumne:
«Wehret den Anfängen».
Diese Reaktion ist nicht weiter verwunderlich. Die DJS griffen das Bürgertum in seinem Kern an. Bis Mitte der 70er Jahre war nämlich praktisch die gesamte Justiz fest in bürgerlichen Händen. «Schon wenn einer in der SP war, wurde er schief angeschaut», erklärt das DJS-Gründungsmitglied Willi Egloff die damalige Situation.
Die Gegenmacht der «Kleinen» unterstützen
Das sollte sich mit der Gründung der DJS ändern. «Die Idee war, dass linke Juristinnen und Juristen zusammenarbeiten sollen. Dahinter steckte der Kollektivgedanke», fasst der erste DJS-Generalsekretär Rudolf Schaller zusammen. Die Absicht bestand darin, die verkrusteten Strukturen im Justizapparat aufzubrechen und linken Standpunkten in Jurist*innenkreisen eine Lobby zu verschaffen. Die DJS wollten «den Abbau gesellschaftlicher Machtstrukturen mit dem Ziel gleicher Möglichkeiten der Selbstverwirklichung für alle», wie es im Protokoll der Gründungsversammlung vom 11. November 1978 heisst.
Als vordringliches Ziel wurde der Zugang zum Recht für alle definiert. «Nach unserer Ansicht wurde das Recht für die Interessen jener instrumentalisiert, die an der Macht waren. Wir wollten die Gegenmacht der ‹Kleinen› unterstützen», sagt das Gründungsmitglied Beat Gsell. Denn damals war es üblich, dass sich Verteidiger*innen als Teil der Justiz verstanden und die Interessen der Klient*innen nicht immer wahrnahmen.
Linke, Arme, Ausländer*innen oder Jugendliche hatten wenig Aussichten auf eine Behandlung, wie sie die Reichen und Mächtigen hatten. Mit vereinsinternen Regeln, die bis heute gelten, wurde dieses Übel bekämpft. Diese legen fest, dass es für DJS-Mitglieder nicht angeht, Stärkere – etwa Vermieter*innen, Versicherungen oder Gewaltverbrecher*innen – gegen Schwächere – etwa Mieter*innen, Versicherte oder Opfer von Gewaltdelikten – zu verteidigen. Dahinter stand die Überzeugung, dass nicht nur die Gesetzgebung selbst, sondern auch jede Anwendung des Rechts stets einen politischen Akt
darstellt. Damit lagen die DJS im Trend, denn sie stellten eine bürgerliche Tradition in Frage, wie es auch alle anderen linken Organisationen taten, die nach dem 68er-Aufstand entstanden sind.
Im Unterschied zu vielen anderen Gruppierungen jener Zeit waren die DJS-Gründer*innen aber keine Revolutionäre, sondern in erster Linie Jurist*innen. Ihnen reichte es, das System zu verändern, es zu stürzen war kein Ziel. Doch das war schon viel. Schon bei der Gründung mussten sie nämlich feststellen, dass sie die Traditionen und den zu Filz neigenden Standesdünkel des Bürgertums nicht ungestraft in Frage stellen durften. In mehreren Prozessen wurde versucht, einige DJS-Mitglieder mit disziplinarischen Massnahmen kaltzustellen.
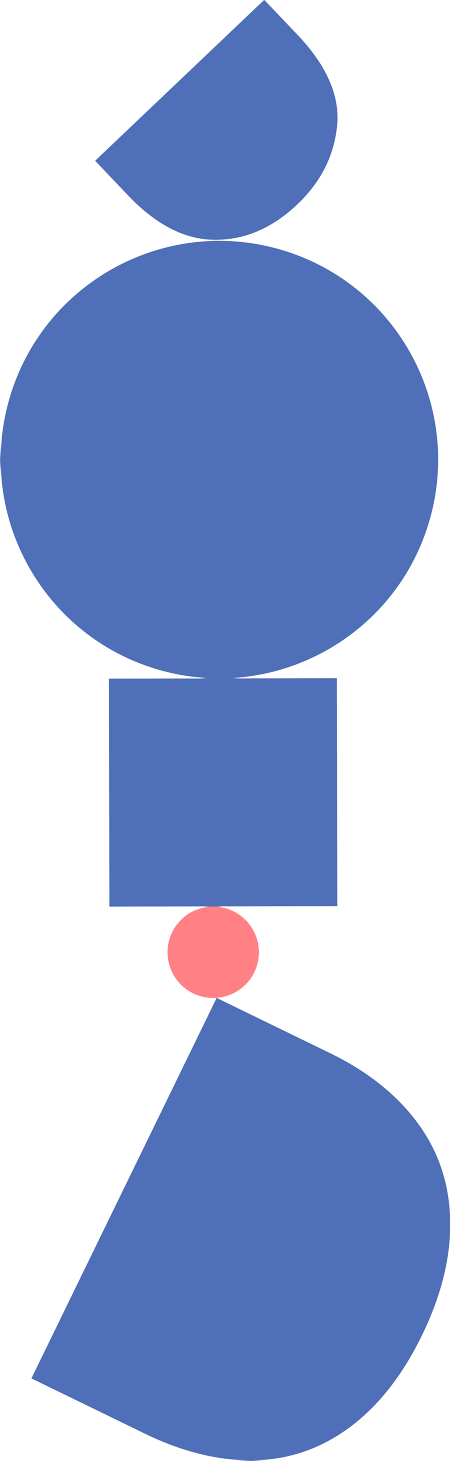
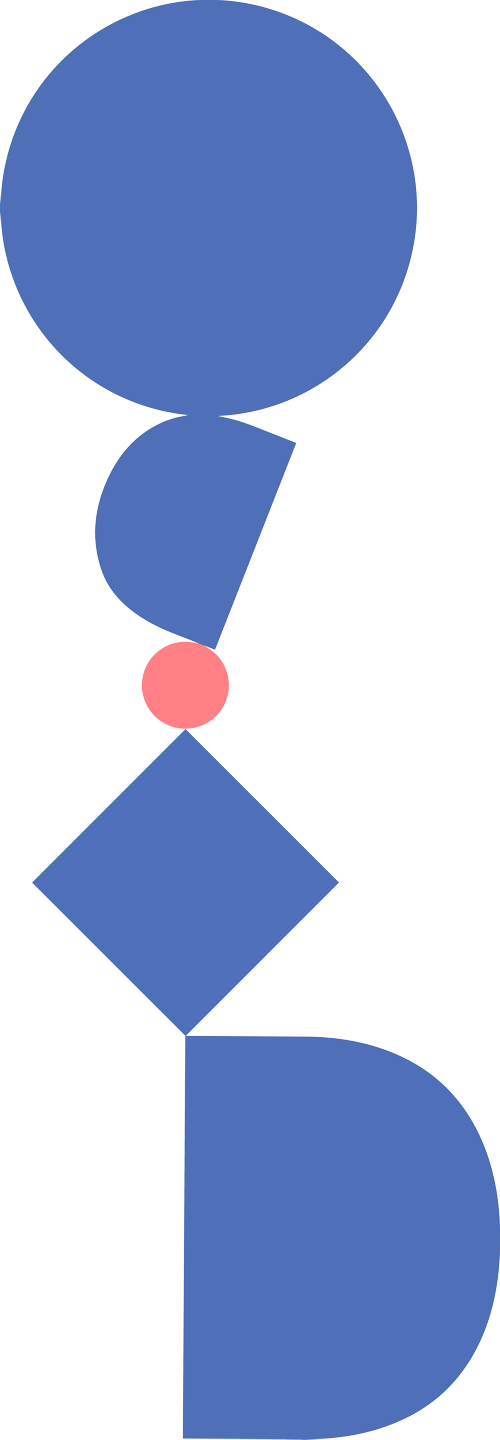
Und immer wieder der Staatsschutz
Die Gründe für diese Reaktion des Establishments liegen auf der Hand. Zwar unterschieden sich die DJS in ihrer politischen Haltung nicht gross von anderen linken Gruppierungen jener Zeit. Was die DJS in den Augen der Machthabenden aber unheimlich machte, war, dass ihre Mitglieder allesamt ausgebildete Jurist*innen waren und nur schwer als Spinner*innen und jugendliche Aufmüpfige abgetan werden konnten. Sie setzten sich nach allen Regeln der Juristerei für die Grundrechte aller Menschen ein – auch beispielsweise von Terrorist*innen.
Dies rief natürlich auch die Bundesanwaltschaft auf den Plan. Bereits ab 1974 wurden die Vorläufer der DJS, regionale Gruppen, die sich Demokratische oder Progressive Jurist*innen nannten, und später auch die DJS selber bespitzelt. Im Berner Generalsekretariat der DJS lagert heute ein 1,5 Kilogramm schweres Dossier, gefüllt mit bundespolizeilichen Beobachtungen, Spekulationen und vermuteten Verschwörungen. Zusätzlich existieren mehrere Dutzend Dossiers über einzelne Mitglieder der DJS.
Der Kampf gegen diese Bespitzelung war seit Beginn eines der bestimmenden Themen der DJS. So setzten sie sich mit Geld und Broschüren gegen die Einführung einer Bundessicherheitspolizei (Busipo) ein, die im Dezember 1978 in der Volksabstimmung scheiterte, und bekämpften ebenso erfolgreich das kriminalpolizeiliche Informationssystem (KIS). Ein weiteres wichtiges Thema war die Revision der Bundesrechtspflege 1989. Die DJS ergriffen das Referendum, weil sie verhindern wollten, dass der Zugang zum Bundesgericht eingeschränkt wurde. Sie taten es mit Erfolg: Sie brachten nicht nur die nötigen Unterschriften zusammen, die Abstimmung konnte 1990 gar gewonnen werden. Daneben standen aber auch Themen wie Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Gleichstellung der Frauen, Ausländer*innenrecht, Konsument*innenrechte oder Scheidungsrecht stets im Zentrum des Interesses. Viele der jährlich stattfindenden Kongresse waren solchen Themenbereichen gewidmet. Um die Ergebnisse der internen juristischen Diskussionen und die politischen Ansichten unter die Leute zu bringen, geben die DJS seit 16 Jahren die Fachzeitschrift plädoyer heraus. Sie löste das Mitteilungsblatt «Volk + Recht» ab und findet nicht nur vereinsintern, sondern in weiten Kreisen von Jurist*innen bis hinein ins Bundesgericht grosse Beachtung.
Mit dem Zeitgeist der 90er Jahre arrangiert
All diese Anstrengungen haben dazu geführt, dass die DJS heute rund 1000 Mitglieder haben. Die Zahl ist im Steigen begriffen. Dies unterscheidet die DJS von den meisten anderen linken Vereinigungen. Praktisch sämtliche politische Parteien, die sich links der SP ansiedelten, existieren nicht mehr oder haben mit grossen Problemen zu kämpfen. Auch die Gewerkschaften, zu denen die DJS von Anfang an einen guten Draht hatten, leiden teilweise unter massivem Mitgliederschwund. Nicht so die DJS. Sie haben sich mit dem Zeitgeist der 90er Jahre, an dem viele andere linke Gruppierungen gescheitert sind, arrangiert. Viele DJS-Mitglieder stehen heute auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, sitzen in Regierungsräten, richten am Bundesgericht, gelten als Staranwält*innen und verteidigen Raphael Huber, Rudolf Bindella oder René Osterwalder und sitzen gar, wie Moritz Leuenberger, im Bundesrat. Dennoch schafft es der Verein, linke Standpunkte beizubehalten, die zwar von den arrivierten Mitgliedern nicht mehr voll unterstützt werden, doch bei der Basis auf grosse Zustimmung stossen.
Prominentestes Beispiel sind die Zwangsmassnahmen im Ausländer*innenrecht. Die DJS haben mit allen Mitteln gegen diese Vorlage gekämpft. Dies, obwohl Moritz Leuenberger als Zürcher Regierungsrat für die Gesetzesänderung eingetreten war. Noch deutlicher zeigt ein Beispiel von 1990 das Spannungsfeld, in dem die DJS heute stehen. Vor der Abstimmung über ihr Referendum gegen die Revision der Bundesrechtspflege veranstalteten sie eine Pressekonferenz, an der ein DJS-Bundesrichter hätte reden sollen.
Dieser sagte jedoch kurzfristig ab mit der Begründung: «Ich möchte mir den Einstieg in meine zukünftige Arbeit nicht durch ein Vorgehen, das als unkollegial angesehen werden könnte, von Anfang an unnötig erschweren.» Trotz dieser schwierigen Bedingungen werden die DJS sowohl intern wie auch extern als glaubwürdig wahrgenommen.
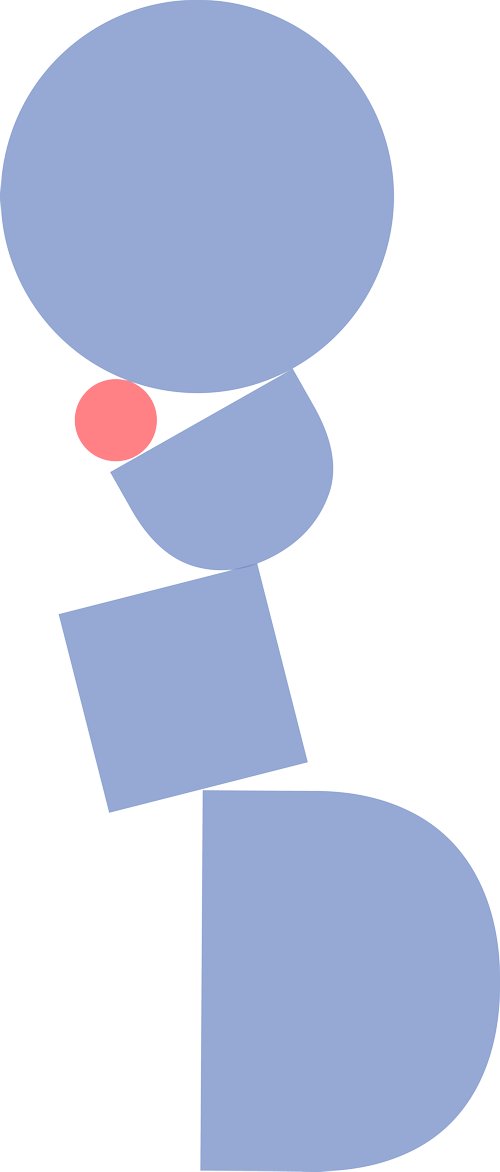
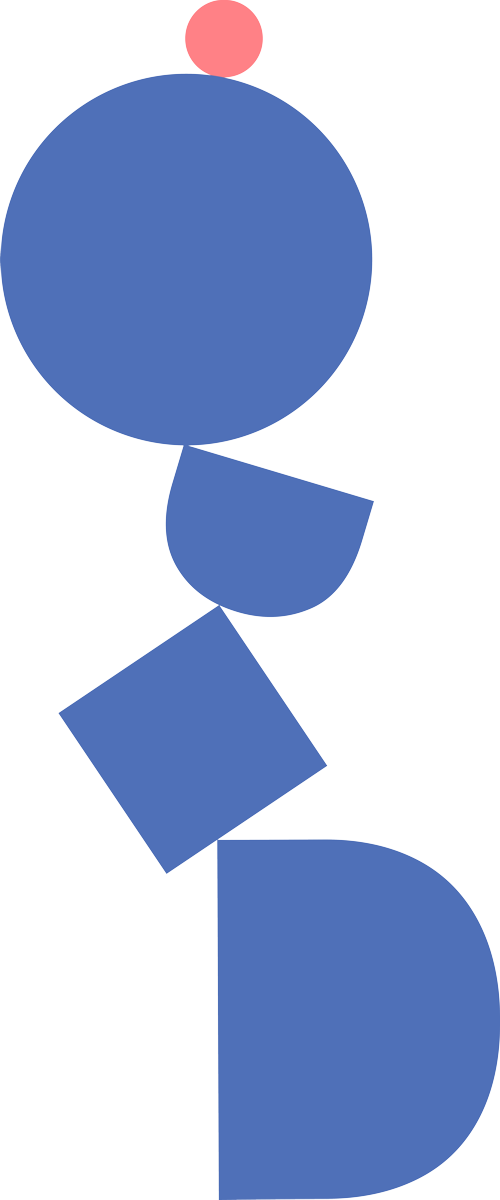
Sich als Berufsverband politisch einmischen
So erklärt etwa der Präsident des Schweizer Anwaltsverbandes, Kaspar Schiller: «Die DJS sind der Sache verpflichtet. Man weiss, woran man ist.» Und auch Judith Wyttenbach, DJS-Vorstandsmitglied und Berner Sekretärin, meint: «Dass unsere Leute an der Macht beteiligt sind, ist für den Vorstand völlig irrelevant.» Man muss ihr diesen Satz glauben, denn viele Mitglieder – vor allem jüngere – attestieren den DJS nach wie vor eine wichtige Rolle in der Politik. So meint etwa der Zürcher Anwalt Christoph Erdös: «Ich finde es gut, wie sich die DJS als Berufsverband politisch einmischen.» Andere reden von der «Hefe im Teig», und auch Kaspar Schiller meint: «Es ist wichtig, dass es die DJS gibt.» Der Bundesrichter Hans Wiprächtiger erklärt gar: «Die Haltung der DJS fliesst in die bundesgerichtliche Rechtsprechung ein. Zudem werden auch plädoyer-Artikel in Bundesgerichtsurteilen zitiert.» Ganz spurlos sind die neunziger Jahre allerdings auch an den DJS nicht vorübergegangen. Der politische Stil musste der Zeit angepasst werden. Provokationen bleiben weitgehend aus. Die politische Arbeit äussert sich nicht mehr in spektakulären Aktionen, sondern findet vor allem im Rahmen von Vernehmlassungen statt. Und die Themen – etwa die Beschränkung des Zugangs zum Bundesgericht – beginnen sich zu wiederholen. Schliesslich finden linke Standpunkte längst nicht mehr denselben Anklang wie noch vor zehn Jahren. So ist in diesem Jahr nicht nur die SOS-Schnüffelstaat-Initiative vor dem Volk gescheitert. Ebenso ist es nicht gelungen, das als indirekten Gegenvorschlag verabschiedete neue Staatsschutzgesetz zu bekämpfen: Für das Referendum fehlten schliesslich rund 300 Unterschriften. Für die DJS war dies ein Rückschlag, denn sie haben sich sowohl für die SOS-Initiative als auch für das Referendum eingesetzt. Da und dort macht sich – vor allem bei den Gründungsmitgliedern – Ernüchterung über diese Entwicklung breit. «Damals war Aufbruchstimmung», sagt Beat Gsell, «man wollte die verkrusteten Strukturen aufbrechen. Heute ist der Zeitgeist ein anderer. Das Engagement flacht ab.» Dabei bleibt vieles zu tun. So erklärt etwa Willi Egloff: «Es gibt nach wie vor ganze Bevölkerungsgruppen, denen der Zugang zum Recht in wichtigen Bereichen verschlossen ist – insbesondere Ausländerinnen und Ausländer.»
Ein Netzwerk zur Verteidigung der Rechte
Auch die Kritiker*innen sind jedoch einhellig der Meinung, dass sich der Aufwand für die DJS bis heute gelohnt hat. Denn vor allem für die Anwält*innen, die in der DJS in der Mehrzahl sind, steht nicht die Politik im Vordergrund. Viel wichtiger ist das Netzwerk von Fachkräften, Freund*innen und Berufskolleg*innen, das sich in den letzten 20 Jahren gebildet hat. Wer immer sich als links denkende Juristin versteht, weiss, dass sie nicht alleine dasteht. Willi Egloff dazu: «Die DJS ist bis heute meine ganze berufliche Infrastruktur. Wenn ich etwas wissen muss, rufe ich einen DJS-Kollegen oder eine DJS-Kollegin an.»
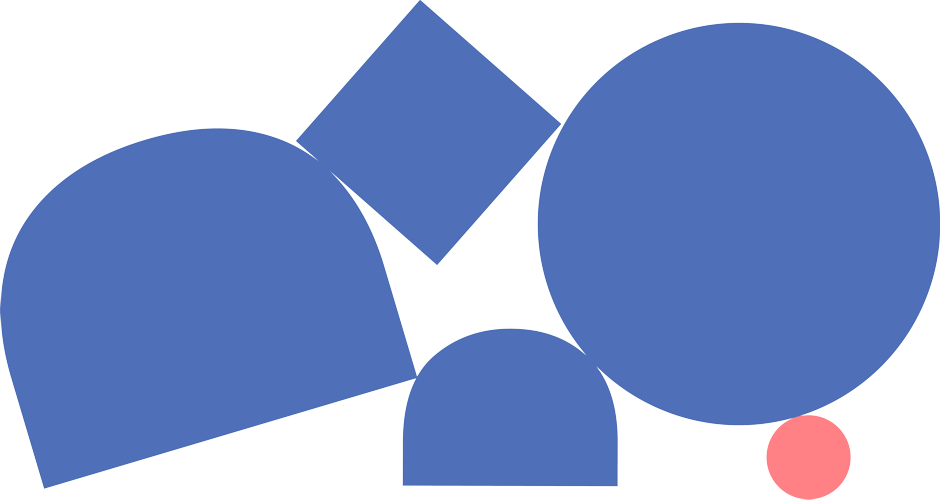
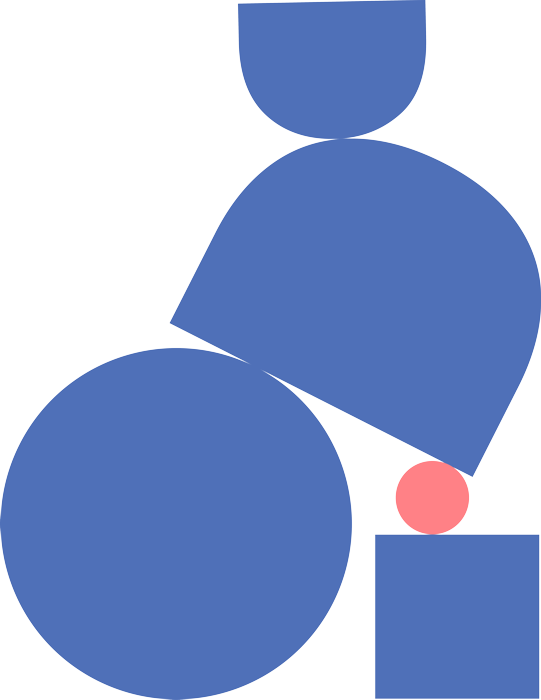
Disziplinierungsversuche,
Bussen und Berufsverbote
Die Gründungsmitglieder der DJS waren den bürgerlichen Behörden ein Dorn
im Auge. Mit Bussen und Berufsverboten wollte man die unbequemen
Jurist*innen kaltstellen. Einige Beispiele: Das Bundesgericht brummt zwischen 1978 und 1982 vier Zürcher
Anwält*innen Berufsverbote im Kanton Bern zwischen fünf und zwölf
Monaten auf, weil sie während des «Pruntruter
Terroristen-Prozesses» eine Pressekonferenz abgehalten, sich in
einem Schreiben «ungebührlich geäussert», den Gerichtssaal
verlassen und Erklärungen an die Presse weitergeleitet haben. In
einem zweiten Verfahren verbietet ihnen das Bundesgericht auch
noch die Berufsausübung im Kanton Zürich für bis zu fünf Monaten.
Als Folge dieser Urteile verliert ein Anwalt ohne Begründung seine
Anstellung als Erwachsenenbildner. Auch seine Ehefrau verliert
ihre Arbeitsstelle in Deutschland von einem Tag auf den anderen.
Aus der Fiche geht später hervor, dass zwischen den Entlassungen
und der Beteiligung am «Terroristen-Prozess» ein Zusammenhang besteht.
Das Anwaltskollektiv in Zürich verschickt bei seiner Gründung
einen Brief, um auf seine Rechtsberatung aufmerksam zu machen. Das
Bundesgericht spricht 1977 Bussen von 200 bis 400 Franken aus
wegen Verstosses gegen das Werbeverbot.
Eine Zürcher Anwältin erhält 1981 vom Bundesgericht eine Busse von
800 Franken, weil sie einen Ratgeber für Menschen herausgegeben
hat, die in ein Strafverfahren verwickelt sind. Der Grund: Ihr
Name in der Broschüre wird als ein Verstoss gegen das Werbeverbot
beurteilt.
Drei Westschweizer Anwälte werden 1982 zu Bussen von 1000 Franken
verurteilt, weil sie bei der Verteidigung von aufmüpfigen
Jugendlichen drei Pressekonferenzen abhalten.
Ein Westschweizer Anwalt erhält einen Verweis, weil er
«ungebührliche Kritik» an einem Richter übt.
Drei Zürcher Anwälte werden 1976 zu Bussen von je 800 Franken
verurteilt, weil sie eine Hungerstreikerklärung von
Untersuchungsgefangenen an die Presse weitergeleitet haben.